Mehr Freizeit, weniger Stress: Warum nicht einfach die 4-Tage-Woche?
- Lesezeit: 10 min.
Eigentlich sind sich die meisten einig: Wir arbeiten viel, manchmal auch zu viel. Nun macht das Modell der 4-Tage-Woche die Runde – mit fast durchweg positiven Ergebnissen.
Ich war ungefähr zwanzig Jahre alt, mein Grossvater bereits über achtzig, als ich mich auf einem Spaziergang mit ihm über Sinn und Unsinn des Lebens unterhielt. Vorsicht ist besser als Nachsicht, dachte ich mir wohl, und fragte meinen Grossvater, ob er irgendetwas bereue, wenn er zurückblicke, ob ihn irgendetwas gräme, er eine Entscheidung heute anders treffen würde. Nein, sagte er, grundsätzlich nicht, er habe es sehr gut gehabt im Leben. Aber, fügte er an, er verspüre eine gewisse Trauer, wenn er daran zurückdenke, dass er den allergrössten Teil seines Lebens damit verbracht habe, sehr viel zu arbeiten.
Von der Lehre bis zur Pensionierung war mein Grossvater Angestellter bei der Schweizerischen Bundesbahn als Mechaniker, reparierte Züge im In- und Ausland und hielt später als Werkmeister das Depot in Schuss. Er mochte seine Arbeit, er war mit Stolz ein «Bähnler» – und er hatte es nicht schlecht. Zwar war der Schichtbetrieb anstrengend, die viele Nachtarbeit auch für die Familie eine Belastung. Gleichzeitig war die Stelle sicher, mein Grossvater wusste die einflussreiche Gewerkschaft der Eisenbahner im Rücken und sich und seine Familie in einem wachsenden Sozialstaat – er war 21 Jahre alt, als 1948 die ersten AHV-Beiträge ausbezahlt wurden – abgesichert. Trotzdem, und das bedauerte mein Grossvater nun, waren es sehr viele Stunden im Depot und sehr wenige in der Familie.

Stunde um Stunde
Die Zeiten waren natürlich andere, weniger zu arbeiten war gar keine Option. Als mein Grossvater in den 40er-Jahren ins Berufsleben eintrat, lagen die heftigsten Arbeitskämpfe eine Weile zurück: Nach dem Landesstreik hatte sich die 48-Stunden-Woche in der Schweiz wie in vielen anderen Industriestaaten als erste einheitliche Normalarbeitswoche durchgesetzt, fast durchweg auf sechs Tage verteilt. In den Jahrzehnten danach wurde um jede Stunde Arbeit beziehungsweise Freizeit gekämpft, einerseits auf eidgenössischer Ebene, andererseits in den Betrieben: Nach dem zweiten Weltkrieg vereinbarten einzelne Berufsverbände wie der Schweizerische Textil- und Fabrikarbeiterverband vertragliche Verkürzungen der Höchstarbeitszeit, in den Gesamtarbeitsverträgen setzte sich allmählich die 44-Stunden-Woche durch. Und in vielen Branchen reduzierte sich die Arbeitszeit in den Jahrzehnten danach Stunde um Stunde.
«Wie lange wir heute arbeiten und morgen arbeiten werden ist also keineswegs eine beiläufige Folge der Modernisierung, sondern Ergebnis zahlreicher sozialer und politischer Kämpfe.»
Heute liegt die Normalarbeitszeit in der Schweiz bei 41 Stunden pro Woche, sieben Stunden weniger also als noch vor hundert Jahren. Immerhin fast ein ganzer Arbeitstag wurde gestrichen. Das ist ein Fortschritt – und keine Selbstverständlichkeit. Ein kurzer Blick in die Geschichtsbücher zeigt, wie lange und mühsam um diese wenigen Stunden Reduktion gestritten wurde. Jede Verkürzung der Arbeitszeit bekämpften die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände vehement. Nur dank zähem und längst nicht immer erfolgreichen Ringen kamen die Arbeiter:innen zu mehr Freizeit. Wie lange wir heute arbeiten und morgen arbeiten werden ist also keineswegs eine beiläufige Folge der Modernisierung, sondern Ergebnis zahlreicher sozialer und politischer Kämpfe. Oder äusserer Umstände: Im zweiten Weltkrieg wurden in vielen Betrieben die Samstag-Arbeitstage als Energiemassnahme gestrichen. Und vielerorts einfach nicht wieder eingeführt. Allmählich verschwand so auch die Sechs-Tage-Woche.
Von fünf auf vier?
Vielleicht war sie deshalb gar nie weg, die Debatte darüber, wie viel wir arbeiten wollen. Nun ist sie unter dem Schlagwort der 4-Tage-Woche zurück. Diese will die gesamte Arbeitszeit, die in einer Volkswirtschaft geleistet wird, kürzen und statt auf fünf auf vier Tage pro Woche aufteilen – bei gleichem Lohn. Es gibt auch Modelle, die die jetzige Arbeitszeit auf vier statt fünf Tage verteilen wollen, meistens ist aber mit der 4-Tage-Woche eine tatsächliche Reduktion der Arbeitszeit gemeint. Die Forderung fällt auf fruchtbaren Boden: Es ist inzwischen bekannt, dass wir uns nicht länger als fünf Stunden am Tag richtig konzentrieren können. Wir leiden an Burnouts, Stress und Schlafstörungen. In vielen Branchen arbeiten wir effizienter und produktiver und machen trotzdem nicht früher Feierabend. Stattdessen lagern wir Versorgungs- und Erziehungsarbeiten entweder an schlecht bezahlte Arbeitskräfte aus oder erledigen sie unter grosser Belastung selber. Und wir wissen: Weniger Pendelverkehr würde auch noch die Emissionen reduzieren. So weit die Theorie.
Auch in der Praxis spricht vieles für eine 4-Tage-Woche: Im März 2023 hat «4 Day Week Global» die Ergebnisse eines Pilotversuchs in Grossbritannien veröffentlicht, an der sich 61 Unternehmen und Non-Profit-Organisationen – die meisten waren KMU – während sechs Monaten beteiligt hatten. Einige der Unternehmen führten dreitägige Wochenenden ein, andere verteilten den freien Tag der Angestellten über die Woche. Die Ergebnisse: weniger Fluktuation, stärkere Umsätze, weniger Berichte über Stress bei der Arbeit, Rückgang der Schlafprobleme, Verbesserung der mentalen Gesundheit. 92 Prozent der Organisationen hielten nach der Testphase an der 4-Tage-Woche fest. Wie so oft eilt auch Island voraus: Im Inselstaat ist die 4-Tage-Woche seit einigen Monaten für 86 Prozent der Arbeitnehmer:innen Realität. Die vorhergehende Testphase war ebenfalls durchweg positiv: Das Risiko für Burnouts sank, die Angestellten wurden gesünder und ausgeglichener. Auch in anderen Ländern gab es erfolgreiche Pilotprojekte und Tests. Einzig aus Schweden gab es auch schlechte Nachrichten: Dort wurde das Experiment einer Arbeitszeitverkürzung trotz positiver Effekte auf die Gesundheit der Arbeitnehmer:innen wieder beendet, weil die wirtschaftlichen Kosten hoch waren.
Warum nicht auch in der Schweiz?
Es tut sich was: Die Zürcher Stadtverwaltung hat im März 2023 bekanntgegeben, die 35-Stunden-Woche testen zu wollen – besonders für Angestellte, die hohen Belastungen ausgesetzt sind, etwa in der Pflege und Betreuung oder bei den Reinigungsbetrieben. Auf eidgenössischer Ebene führen die Gewerkschaften und linken Parteien die Arbeitszeitreduktion wieder prominenter in ihrem Programm und auch soziale Bewegungen haben sich der Reduktion angenommen, weil sie positive Effekte auf die Gesundheit, auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und auf das Klima hätte. Auch eine eidgenössische Initiative ist in der Startlöchern – die es allerdings schwer haben wird, wenn wir uns an die krachende Niederlage der Initiative für sechs Wochen Ferien erinnern.
Denn obwohl viele der Meinung sind, wir arbeiteten zu viel, sind auch viele der Meinung, so viel Arbeit sei zur Sicherung des Wohlstandes in der Schweiz nötig. Vor dessen Verlust warnen auch Wirtschaftsverbände immer wieder, wenn es um die Reduktion von Arbeitszeit geht. Gemeint ist damit allerdings meistens nur der finanzielle Wohlstand – der nicht mal allen zugute kommt. Und ich frage mich je länger je mehr, was Wohlstand überhaupt bedeutet. Vielleicht auch: frei über seine Zeit verfügen zu können. Zu arbeiten, um zu leben, statt zu leben, um zu arbeiten, wie es so schön heisst.
Heute erinnert mich das Modell einer Weichenlaterne auf meinem Bücherregal an meinen Grossvater und das Erbe der «Bähnler». Die Eisenbahner hatten im Landesstreik vom November 1918 eine tragende Rolle gespielt: Vom Verkehrsknotenpunkt Olten verbreiteten sie ihre Forderungen im ganzen Land – und stiessen damit eins der wichtigsten gesellschaftspolitischen Ereignisse der Schweiz mit an. Mit auf dem Forderungskatalog: Die Beschränkung der Wochenarbeitszeit. Ich kam in dem Jahr zur Welt, in dem mein Grossvater mit einer guten Rente in Pension ging. Trotzdem bin ich mir sicher: Auch er hätte für die 4-Tage-Woche eine Weiche gestellt.

Weitere Artikel
-

Weniger depressiv dank Folsäure?
Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass Folsäure eine präventive und zum Teil auch therapeutische Wirkung bei Depressionen hat.
-

Schokoladen-Brownies aus Bohnen
Wer hätte schon gedacht, dass Schokoladen-Brownies aus schwarzen Bohnen so lecker sein können? Ganz ehrlich: Wir nicht. Ein köstlicher Snack, der durch die Haferflocken und schwarzen Bohnen auch in Sachen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente reichlich punkten kann.
-

Weniger Geburtsfehler dank Folsäure
Mit einer frühzeitigen Folsäure-Prophylaxe kann das Risiko von vielerlei Geburtsfehlern nachweislich reduziert werden.
-

Dinkelspaghetti mit Linsenbolognese
Einfach, wahnsinnig lecker und vor allem alltagstauglich: Die Linsenbolognese begeistert nicht nur Gäste, sondern auch kleine Essende. Linsen stecken zudem voller gesunder Nährstoffe. Einmal gekocht, kann das Gericht nicht mehr weggedacht werden!
-

Das kleine 1×1 der Folsäure
Trotz steigender Bekanntheit ist das Folsäure-Wissen meist nicht sehr fundiert. Deshalb hier die Antworten auf ein paar ganz grundsätzliche Fragen.
-

Innovative Folsäure-Prophylaxe
Für Frauen mit Kinderwunsch gibt es eine grosse Auswahl an Produkten zur Folsäure-Prophylaxe. Pre-Natalben® ist das einzige mit Quatrefolic® und Vitamin B12. Eine Kombination, die überzeugt.
-

Pumpernickel mit Randenhummus, Spinat und gekochtem Ei
Dieses Frühstück ist farblich ein richtiger Knaller! Begeistern tun die feinen Brötchen aber nicht nur wegen ihren Farben, sondern auch wegen ihrem Geschmack und ihren Vitaminen. Voller Eisen, Proteine und Folsäure startest du mit diesem super einfachen Rezept perfekt in den Tag.
-

Schnelles Süsskartoffel-Curry
Wer’s gerne bunt & frisch mag, wird dieses schnelle Süsskartoffel-Curry lieben. Verfeinert mit Rüebli, Federkohl und feurigem Ingwer, schmeckt es einfach superlecker und ist in Kürze zubereitet.
-
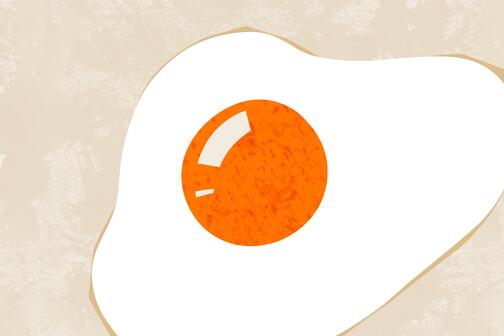
Das Ei
Das Ei wird noch immer von zahllosen Mythen begleitet. Die grössten Irrtümer bezüglich Cholesteringehalt und Salmonellen sind mittlerweile wissenschaftlich widerlegt. In diesem Artikel klären wir Fragen und zeigen die ungeahnte Superpower vom Ei auf.
-

Da hat's Folsäure drin
Produkte mit einer Extraportion Folsäure erkennt man in der ganzen Schweiz am Folsäure-Label auf der Verpackung. Bereits gegen 200 Artikel sind mit diesem Label gekennzeichnet – und es werden von Jahr zu Jahr mehr.
-

Hier werden Folsäure-Werte ermittelt
Das labor team ist eines der führenden medizinischen Labore in der Schweiz. Zum umfangreichen Angebot gehört auch die Folsäure-Diagnostik. Vor allem für Frauen mit Kinderwunsch empfiehlt es sich, den Folsäure-Wert schon vor der Schwangerschaft zu überprüfen.
-

Wenn der Berg ruft
Wandern tut gut – auch während der Schwangerschaft. Damit der Ausflug in die Berge für die werdende Mutter und das Ungeborene zum maximalen Genuss wird, sollten einige Dinge beachtet werden.
-

Kartoffeln – für ein gutes Bauchgefühl
Einst war die Kartoffel eines unserer wichtigsten Grundnahrungsmittel, heute wird sie meist als Beilage degradiert. Wer jedoch etwas tiefer gräbt, erkennt, dass die Kartoffel viel mehr kann als Rösti, Pommes frites und Co. – gerade auch im Hinblick auf die Schwangerschaft.
-

Omega-3, D3 und K2 in einer Kapsel
Wer den Bedarf an Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren mit Nahrungsergänzungsmitteln optimal decken möchte, kann dies ab sofort mit einem einzigen, rein pflanzlichen Präparat tun.
-

Ich oder du
Wer stand früher auf den Skiern? Wer war braver in der Schule? Im «Ich oder Du» haben Maria Walliser und Ramon Zenhäusern auch nebst ihren Karrieren im Ski-Weltcup viele Gemeinsamkeiten entdeckt.
-

Möglichst alles offen lassen
Für uns war klar: Egal, welches Geschlecht unser Kind hat, es wird Bodys in jeder Farbe tragen und später mit Playmobil-Autos und / oder Puppen spielen können. Wie schon beim älteren Bruder, der bis in den Kindergarten lange Haare hatte, Nagellack und pinke Kleider trug, weil das seine Lieblingsfarbe war, wollten wir bei unserer Tochter alles offen lassen.
-

Folsäure-Vorbild Sonnwendlig
Das alkoholfreie Sonnwendlig ist das erste Schweizer Bier mit einer Extra-Portion Folsäure. Die Brauerei Locher bekräftigt damit ihr Engagement für die Stiftung Folsäure Schweiz.
-

Küchengespräch
Karl Locher ist zu Gast in Maria Wallisers Küche. Von seiner Brauerei in Appenzell hat er unter anderem eine Portion Biertreber mitgebracht. Gemeinsam kochen sie ein klassisches Schweizer Gericht auf nicht ganz klassische Weise und plaudern dabei über Bier, Ernährung im Spitzensport und Folsäure.
-

Smoothie mit Weizenkleie, Banane und Spinat
Grüne Smoothies waren bisher nicht dein Ding? Dann solltest du diesen Wundertrank probieren! Es ist der perfekte grüne Smoothie für Einsteiger:innen und natürlich für alle, die sich etwas Gesundes gönnen möchten. Wetten, dass du deine Meinung änderst?
-

Das Beste aus der Natur für die Kleinsten
Wer sein Kind konsequent mit Bio- oder Demeter-Produkten verwöhnen will, entscheidet sich meist für Holle. Wie das Unternehmen zum Ziegenmilch-Trendsetter wurde, ob auch Kinder auf pflanzliche Milch-Alternativen stehen und was in Sachen Milchnahrung als Nächstes kommt, verrät Geschäftsführer Udo Fischer im Interview.
-

Die Zuckerfalle
Die Regale sind voll von zuckerhaltigen Produkten. Ob Brot, vegane Fleischersatzprodukte oder Fertigsaucen – überall ist der süsse Stoff enthalten. Doch was macht Zucker mit uns, und worauf sollten wir gerade bei Kindern achten, wenn es um eine zuckerarme Ernährung geht?


